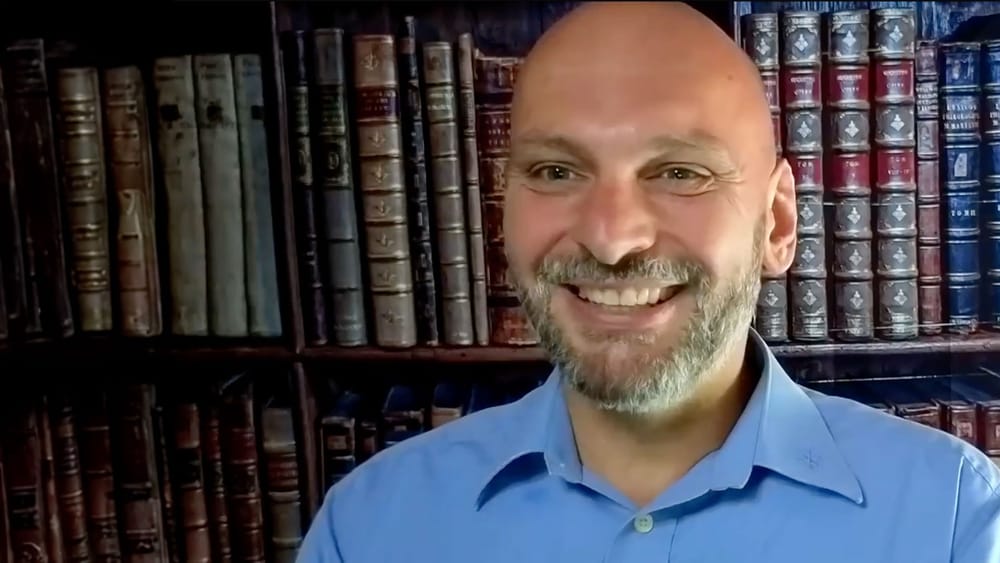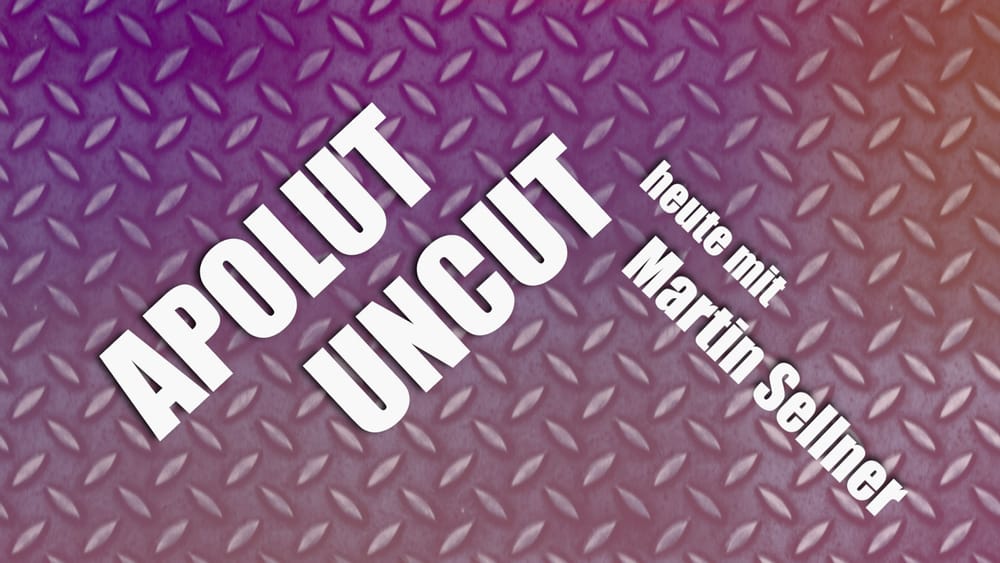“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Egal ob New York, Paris, London, Brüssel oder Amsterdam: westliche Metropolen dienen oft nur als Übergangsstation. Ein Großteil der Bewohner kommt im Alter von 20 Jahren. Ziel: Ein Studium zu absolvieren, ein wildes Nachtleben abzufeiern, sich temporären Urlaub vom bürgerlichen Leben zu gestatten, Teil eines urbanen Mythos zu werden. Metropolen ermöglichen die non-stop-Pubertät. Das Meiste, was Erzieher einem eingebläut haben: In der Großstadt hat es kaum Bedeutung. Man kann sich stylen wie man will. Was in Kleinstädten mit sozialer Todesstrafe geahndet wird, findet hier nicht mal Beachtung.
Aber dieser Befreiungseffekt nutzt sich ab. Schon bald werden – heimlich und kaum bemerkt - erste Weichen zur Rückkehr ins Bürgertum gestellt. Karrierechancen tun sich auf. Jobs mit Sozialversicherung winken. Oft genug in anderen Städten, oder gar aus der Provinz. Oder: Nachwuchs kommt – ob gewollt oder ungewollt. Dann ist es Zeit, das Selbsterfahrungs-Labor zu räumen. Der Zug des Lebens fährt weiter. Es zeigt sich: Die Metropole, das war nur eine exotische Zwischenstation.
Die französische Regisseurin und Autorin Virginie Despentes hat dieses Phänomen in ihrem Roman „Vernon Subutex“ beschrieben. Die Handlung spielt im Paris der Jahrtausendwende: Der vierzigjährige Titelheld verliert seinen Job. Er landet beim Sozialamt. Dort rebelliert er gegen die Schikanen der Sachbearbeiter. In Gegenzug streichen die ihm die Stütze. Zwangsräumung und Obdachlosigkeit folgen. Zum Couch-Surfing gezwungen, sucht Subutex nach früheren Freunden und Bekannten. Dabei stellt er fest: Die sind entweder an einer Überdosis gestorben, in Arbeits- und Familienstrukturen versunken oder haben die Seine-Metropole verlassen. So weit, so normal. Dennoch: Die Flucht von 150.000 Einwohnern aus Berlin ist damit nicht ganz vergleichbar. Bei der Stadtflucht aus Berlin, über die so viele Medien berichten, kommt ein weiterer Faktor hinzu. Und welcher ist das? - Nun, die Spree-Metropole hat ihren mythischen Mehrwert verloren.
Ältere Hörer werden sich erinnern: Keine Stadt war in den Neunzigern so angesagt wie Berlin. Mehr noch als Barcelona. Oder als Amsterdam während der Siebziger. Der Zusammenbruch der DDR ließ den Ostteil Berlins als Abenteuerspielplatz zurück. Alte bröcklige Häuser, großteils Staatseigentum, waren ohne Besitzer. Man zahlte Spottmieten oder erklärte die Bruchbuden für besetzt, zum Wohnprojekt. Für 1 bis 2 DM versorgten selbsternannte „Volxküchen“ die Bewohner mit Fisch und Chips oder Spaghetti mit irgendeinem Gemüse. Einmal pro Woche öffnete in Mitte die „After Sozialamt-Lounge“ ihre Tür. Exakt um 18 Uhr, wenn die Ämter ihre Pforten schlossen. Und überall: Performances, Konzerte und Ausstellungen. Punkbands wie „Köterkacke“ oder „Madonna Hip Hop-Massaker“ sorgten für abendliche Lärmkulissen. Durchgeknallte Zukunftsphantasien fanden Ausdruck: Der Autor Tim Staffel träumte sich das künftige Berlin als „Terrordrom“ während Junkie-Philosoph QRT (sprich: Kurt) einen Serienkiller-Boom in Ostdeutschland erhoffte. Daraus wurde leider nix. Aber eine ganz andere Art von Terror und Massenmord setzte ein. Der Mord an der Stadt selbst: Die Gentrifizierung. Auch dies ein allgemeingültiges Gesetz: Überall, wo es rund geht, schlägt bald die Gentrifizierung zu. Ob Berlin, Amsterdam oder Detroit: Je wilder die Stadt, desto begieriger die Investoren. Die spekulieren auf Kids mit reichen Eltern. Aufgewachsen in goldenen Käfigen, geködert vom antibürgerlichen Szene-Flair und mit Papas Kreditkarte stürmen sie die Kreativ-Viertel. Exotik und Wildheit, ja bitte! Aber nicht ohne Komfort! Bald kommt es zu Luxussanierung, Eröffnung von Boutiquen, und dem Anstieg von Lebenshaltungskosten. Die Kreativszene wehrt sich kurzzeitig, um dann die Segel zu streichen. Regelmäßig gegen Räumungstrupps zu kämpfen, ist langfristig ermüdend.
Vor Jahren bot die Reichenberger Straße in Kreuzberg ein Lehrbuch-Beispiel für Gentrifizierungs-Strategien. Ausgerechnet in der Straße mit der höchsten Kriminalitätsrate wurde ein luxuriöses Wohnhaus errichtet - sogar mit Aufzug fürs eigene Auto. Ein Zaun plus Wärterhäuschen demonstrierte die Entschlossenheit der Eigentümer. Motto: Ihr haltet uns nicht auf! Zwar flogen ständig Farbbeutel gegen die Außenwände. Aber ebenso regelmäßig ließ man sie reinigen. Ein Wettkampf fand statt. Wer macht als erster schlapp: Die Hipster oder die Farbbomber? Leider hatten die Hipster den längeren Atem. Ex-Finanzsenator Thilo Sarrazin hatte bereits 2009 gegenüber dem Magazin „Lettre“ eine Metamorphose Berlins prognostiziert: Von der „Hauptstadt der Transferleistung zur Metropole der Eliten“. Das ist leider eingetroffen. Nur, dass Gutverdiener nicht zwingend zur Elite gehören...
Im Durchschnitt brauchen Gentrifizierer zehn Jahre, um pulsierende Städte in Friedhöfe zu verwandeln. Auch Berlin ist zur luxuriösen Ruhestätte avanciert. Menschen mit geringem Einkommen hingegen können sich ihre Bude nicht mehr leisten, oder finden erst gar keine mehr. Die Spree-Metropole, einst unüberbietbar preiswert, hat jedes Maß verloren. Ich erinnere an eine meiner favorisierten Ortschaften: Den Charlottenburger Savinyplatz. Dort, in den Eisenbahnbögen, befinden sich drei Buchläden. Perfekt zum Stöbern und Schmökern. Ich kaufte dort regelmäßig Bücher, nahm sie ins benachbarte Cafe, startete dort die Lektüre. So auch im letzten Jahr. Und wie immer bestellte ich eine kleine Tasse Kaffee plus ein Glas Sprudelwasser. Dann die Rechnung: Fast neun Euro. Neun! Mit einem Schlag wurde klar: Die Stadt schmeißt mich raus. Sie will Bewohner mit größerem Geldbeutel. Überall schließen sich Türen. Die große Aussperrung beginnt. Gastronomie und Handel stellen sich auf Neureiche und Touries ein. Ihnen bleibt keine Wahl: Wie sonst die horrende Gewerbemieten eintreiben? Denn so leicht Berliner Geldbeutel inzwischen auslaufen, so schwer kriegt man sie gefüllt. Gut bezahlte Jobs sind Mangelware. Und wird einer frei, haben Konkurrenten ihn längst besetzt. Das zwingt geschwächte Einzelkämpfer zur Kapitulation. Zumal mit dem Alter der Bedarf nach Komfort zunimmt und tragfähige soziale Netzwerke meist abnehmen – so wie Vernon Subutex es in Paris erfahren musste.
Das Problem des Einkommens betrifft besonders die Kreativberufe. Künstler, durchaus begabt, erliegen in Berlin dem Konkurrenzdruck. Der Autor dieses Podcasts weiß von einem jungen Maler aus der dänischen Provinz. Der hatte sich bereits ein kleines Vermögen zusammen gepinselt. Aber: als dieser Provinz-Picasso nach Berlin zog, wurde schnell klar - hier findet er keinen Platz. Nur Minigalerien stellten ihn aus, verkauften fast nichts. Nach einem Jahr zog er wieder heimwärts. Vielleicht vermisst er manchmal noch das Berliner Nachtleben, die mitternächtlichen Dönerläden und Spätis. Aber sein Einkommen stimmt wieder.
Aktuell, im Jahre 2025, wackelt sogar die Upper Class-Kultur. Große Bühnen und keimfreie Museen fürchten um ihre Subvention. Das einzige, was hier noch läuft, ist ängstliche Selbstzensur. Eine Bloggerin der Website „Beige“ verglich die aktuelle Situation Berlins mit der von 1933: „Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch gar nicht hier lebte, das Buch „Goodbye to Berlin“ von Christopher Isherwood gelesen. Ein bisschen so fühle ich mich jetzt. Vielleicht etwas weniger Bohème und Schrägheit, aber doch in so einem Zwischenstadium. Die Stadt hat mich genauso verschlungen wie den Autoren. Und mich heile wieder ausgespuckt, damit ich weiterziehen kann.“ Schön für sie. Aber ist die Stadt wirklich unrettbar verloren? Unter welchen Bedingungen könnte sie auferstehen? - Vielleicht bieten sich nur Reanimierungs-Chancen, wenn wirkliche, tiefgreifende Um- oder Zusammenbrüche einsetzen? Wie nach dem Ersten Weltkrieg oder nach dem Mauerfall. Danach steppte ein Jahrzehnt der Bär, um schließlich wieder in den Winterschlaf zurückzusinken. Metropolen wie Berlin funktionieren wie die Rose von Jericho. In der Wüste liegt sie jahrelang wie vertrocknet, aber kaum fällt erster Regen, blüht sie auf. Mit anderen Worten, wer sich dem Wegzug-Trend verweigert, der kann nur auf die nächste Großkrise, den nächsten Totalzusammenbruch hoffen. Darauf vertrauend, dass die Stadt dann wieder toben wird.
Ein weiterer Trost für Verbliebene und Vertriebenen: Auch die Upper-Class-Zuzöglinge bleiben nicht auf Lebenszeit. Irgendwann nervt die urbane Freiheit. Was in der Jugend kickt, bringt im Alter auf die Palme. Spätestens beim Eigentumshaus will man kein Graffiti mehr an den Wänden. Dann fordern sie: Schließung der Cafes um 22 Uhr, Verkehrsberuhigung und private Putzkolonnen. Außerdem räumt spätestens die Midlifecrisis mit jugendlichen Illusionen auf. Man erhoffte sich eine gigantische Zukunft, betrieb Selbstausbeutung in diversen Start-Up-Projekten, kam aber über das Mittelmaß nie hinaus. Oder: Das Gewollte wurde erreicht, erwies sich jedoch als Fata Morgana. In beiden Fällen gilt: Man möchte den Ort des Scheiterns verlassen. Zumal bereits die nächste Generation nachrückt und völlig neue Geschmacksrichtung, gänzlich neuen Stil mitbringt. Da schrumpft manche Kiez-Größe zum Fremdkörper. Man spürt: Die eigene Zeit, die eigene Chance ist verstrichen. Ein weiterer Grund: Das Erwachen von Beschützerinstinkten gegenüber frisch gezeugten Kindern. Erteilen wir noch einmal der „Beige“-Bloggerin das Wort. Zitat: „Als Mutter fühle ich mich einfach unwohl, wenn ich mit meinen kleinen Kindern über den Bahnsteig gehe und von Dealern trotz Kinderwagens immer wieder angesprochen werde. Nennt mich spießig, aber ich finde, das müssen meine Kinder nicht sehen. Zumindest nicht dauernd.“ Der Z-Promi Max Simonischek begründet seine Berlinflucht ähnlich: Die Stadt hindere ihn, seinem Nachwuchs eine Vorstellung von Ästhetik zu vermitteln. Hier läge überall Dreck und Müll, seinen Kindern würde er „diesen Anblick auf ihrem Schulweg gerne ersparen.“
Dennoch, und aller schrägen Argumentation zum Trotz: Manchmal können Metropolenflüchtige einen schon verunsichern. Vor allem, wenn sie nach Jahren ihren einstigen Wohnort besuchen und dann versichern: Nein, die Berlinflucht bereue man keinesfalls. Die Stadt sei ihnen völlig fremd geworden. Solche Behauptung bringen selbst treueste Standhalter ins Grübeln. Dagegen hilft nur eins: Den Spieß umzudrehen. Die angeblich glücklichen Berlin-Flüchtigen in ihrem neuen Wohnorten besuchen. In den süddeutschen Kleinstädten beispielsweise, wo nachts die Straßen leer sind, das einzige Cafe um 17 Uhr dichtmacht, und weder Kino noch Bühne zum Besuch einladen. Wo jeder sich im familiären Eigenheim verschanzt und eine Fußgängerzone als Jugendtreff herhalten muss. Wo der letzte Zug um 20 Uhr abfährt. Nur wenige Stunden genügen, und man ist wieder froh, zurück in seiner Metropole zu sein. Auch wenn sie randvoll mit Hipstern gefüllt ist.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: Werner Spremberg/ shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoinzahlung
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut